Naturschutzrelevante Gutachten in Bayern
Artenhilfsprogramm Felsbrüter: Maßnahmen zum Schutz und zur Bestandsförderung für Uhu und Wanderfalke in den Jahren 2018 bis 2020. Schlussbericht (Jahresbericht 2020)
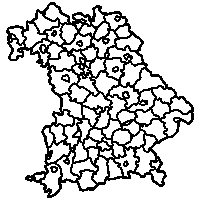
Zusammenfassung
Der Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. (LBV) betreibt und koordiniert in Bayern mit Förderung und im Auftrag verschiedener Behörden des Freistaats Bayern seit Anfang der 1980er Jahre landesweit Schutzmaßnahmen für den Wanderfalken und seit 2001 auch für den Uhu. Ein Großteil dieser Maßnahmen werden im Auftrag des Bayerischen Landesamts für Umwelt (LfU) im „Artenhilfsprogramm Felsbrüter“ umgesetzt. Dieses beinhaltete 2020 folgende Aufgabenschwerpunkte: • ein systematisches Bestands- und Brutmonitoring in ausgewählten Teilregionen (Nördlicher Frankenjura, Teile des südlichen Frankenjura, Isar- und Loisachtal sowie ausgewählte Reviere des Inn- und Salzachtals mit Maßnahmenbezug, • die Sammlung von Streudaten zum Vorkommen und zur Reproduktion beider Arten außerhalb der systematisch und zumindest annähernd flächendeckend kontrollierten Probeflächen, • die Organisation, Umsetzung und Kontrolle von Lenkungsmaßnahmen in klettersportlich intensiv genutzten Regionen (im Nördlichen und in Teilen des Südlichen Frankenjura sowie im Werdenfelser Land) in enger Kooperation mit verschiedensten anderen Interessengruppen (DAV, IG Klettern, im Werdenfelser Land auch Bergwacht und Bundeswehr), • die Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Sicherung sekundärer Lebensräume für den Uhu in Abbaustätten in Kooperation mit den Betreibern und den Industrieverbänden in Unterfranken und in den Landkreisen Neumarkt und Amberg-Sulzbach, • weitergehende Beratungsleistungen gegenüber Behörden und breiter Öffentlichkeit Dieses Aufgabenspektrum - insbesondere das zeit- und personalaufwändige Bestands- und Brutmonitoring - wird zu großen Teilen durch rund 150 ehrenamtliche Mitarbeiter des LBV und seiner Partnerverbände - etwa der Aktion Wanderfalken- und Uhuschutz e.V. (AWU) abgedeckt. Diesen gilt für ihr Engagement besonderer Dank! Der Erhaltungszustand der Zielarten stellt sich aufgrund der erhobenen Bestands- und Reproduktionsdaten unterschiedlich dar: Der Bestand des Wanderfalken in Bayern wird aktuell auf 260-280 Paare geschätzt (RÖDL et al. 2012). Systematisch und flächendeckend erhobene Bestands- und Brutdaten liegen im Berichtsjahr aus dem Artenhilfsprogramm und anderen Erhebungen allerdings nur für 67 WanderfaIkenvorkommen in Unterfranken und im Nördlichen Frankenjura vor. Zudem sind meist unsystematisch erhobene, oft lückenhafte Streudaten zu weiteren 49 Revieren in anderen Regionen Bayerns eingegangen. Diesen Daten zufolge hat sich der Bestand in allen klassischen Verbreitungszentren nach stetigem, sich über viele Jahre erstreckenden Anstieg wieder mindestens auf dem Niveau vor dem ‚pesticide crash‘ der 1950er und 1960er Jahre stabilisiert. Aber auch außerhalb der klassischen Verbreitungszentren hat der Wanderfalke in den letzten Jahren als Bauwerksbrüter noch bislang unbesiedelte Regionen erschlossen. Zu deren Status sind aufgrund der wenigen vorliegenden Daten derzeit aber kaum gesicherte Aussagen möglich. Der Bruterfolg des Wanderfalken bleibt zwar in vielen Regionen - etwa im Bayerischen Wald und im Nördlichen Frankenjura - hinter den Erwartungen an eine sich selbst erhaltende Population zurück, dies wird aber offenbar durch Reproduktionsüberschüsse in anderen Regionen immer noch ausgeglichen. Zugleich sind derzeit keine Gefährdungen erkennbar, die die Gesamtpopulation des außeralpinen Raums bedrohen könnten, sieht man einmal von dem hohen Störungsdruck auf die Felsbrutvorkommen in den stark von Sportkletterern frequentierten Mittelgebirgsregionen ab. Deren Zahl nimmt seit Jahren stetig zu, und damit auch der Störungsdruck auf die Felsbruthabitate der Mittelgebirge. Besonders deutlich wurde dies im Berichtsjahr 2020: Die anfänglichen Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen in Folge der COVID-19-Pandemie haben zwar zunächst für eine Beruhigung gesorgt. Nach deren Aufhebung hatte diese dann aber wegen der weiter bestehenden Beschränkungen für Reisen außerhalb Deutschlands eine deutlich höhere Besucherfrequenz z.B. an den Kletterfelsen des Frankenjura zur Folge. Bislang begegnen dem wachsenden Störungsdruck noch sehr effektiv die in enger Kooperation mit dem Deutschen Alpenverein und der IG Klettern umgesetzten Lenkungsmaßnahmen, die in der „Szene“ der Sportkletterer aufgrund der über Jahre aufgebauten, soliden Vertrauensbasis sehr gut akzeptiert sind. Aber die Fortführung dieser aufwändigen Maßnahmen bleibt auch in Zukunft unabdingbar, wenn man die über Jahre im Wanderfalkenschutz mühselig aufgebauten Erfolge nicht aufs Spiel setzen möchte. Eine neue Gefahr könnte dem Wanderfalken zudem im derzeit ebenfalls boomenden ‚Geocaching‘ erwachsen. Diese noch junge Trendsportart verschärft den in primären Bruthabitaten ohnehin schon bestehenden Störungsdruck. Unklar ist die Situation des Wanderfalken in den Bayerischen Alpen: Für das Werdenfelser Land fehlen seit 2009, für die übrigen Regionen seit Ende der 1980er Jahre systematische Erhebungen, und selbst Streudaten sind – wenn überhaupt – nur sehr punktuell verfügbar und nicht aussagekräftig. Es gibt aber Hinweise, dass auch dort der Störungsdruck durch den Klettersport lokal ein ernsthaftes und zunehmendes Problem darstellt. Dass im Rahmen des Artenhilfsprogramms seit 2013 aus den Erfahrungen aus den Besucherlenkungskonzepte in den Mittelgebirgen heraus erste analoge Regelungen im Werdenfelser Land etabliert werden, ist daher ein wichtiger Schritt zur Sicherung der alpinen Wanderfalkenvorkommen zu werten - die Maßnahmen sollten unbedingt dauerhaft fortgeführt werden und auch andere Regionen des bayerischen Alpenraums einbeziehen. Der Bestand des Uhus in Bayern wird auf 450-550 Paare geschätzt (RÖDL et al. 2012; VON LOSSOW mdl.). Im Artenhilfsprogramm wurden 2020 Bestands- und Brutdaten zu insgesamt 232 besetzten Revieren in Unterfranken, im Nördlichen und in Teilen des Südlichen Frankenjura sowie entlang von Isar, Inn und Salzach erhoben. Zudem liegen Streudaten zu 53 besetzten Revieren außerhalb dieser systematisch bearbeiteten Probeflächen vor. Diesen Daten zufolge ist der Bestand des Uhus in Bayern derzeit als mindestens stabil einzuschätzen. Im Gegensatz dazu steht die im langjährigen Mittel in vielen Regionen Bayerns niedrige Reproduktion: 2020 war der Bruterfolg in den meisten Probeflächen des Artenhilfsprogramms – wohl aufgrund der niedrigeren Nahrungsverfügbarkeit (Kleinsäuger) – zwar etwas geringer als im Vorjahr, die Zahlen liegen jedoch noch deutlich über denen des Jahres 2018. Trotzdem wurden aber auch im Berichtsjahr 2020 nur im östlichen Unterfranken die Anforderungen an eine sich selbst erhaltende Population nach DALBECK (2003) erreicht (mindestens 1,0 juv. / besetztes Revier). Im langjährigen Mittel wird dieser Zielwert nur im westlichen Unterfranken erreicht, alle übrigen systematisch erfassten Regionen bleiben weit dahinter zurück (0,54 – 0,73 juv. / besetztem Revier). Möglicherweise ist der Zielwert für Bayern zu hoch angesetzt, trotzdem aber sind die regionalen Diskrepanzen in der Reproduktion innerhalb Bayerns und zu Verbreitungszentren in anderen Bundesländern auffällig und kritisch zu sehen. Mit der anhaltend niedrigen Reproduktion gehen eine Reihe aktueller Gefährdungsfaktoren einher: • Der Störungsdruck durch Natursportarten hat auf den sehr störungsempfindlichen und ganzjährig am Brutplatz ansässigen Uhu noch deutlichere Auswirkungen als auf den Wanderfalken. Dies betrifft insbesondere den Klettersport. Dem Störungsdruck an bekletterten Brutfelsen kann im Rahmen des Artenhilfsprogramms nur durch die oben genannten intensiven Lenkungsmaßnahmen ausreichend begegnet werden, wie sie im Rahmen des Artenhilfsprogramms im Frankenjura aber – zumindest in ersten Ansätzen - auch schon im bayerischen Alpenraum umgesetzt werden. An einzelnen Brutplätzen führen auch andere Natursportarten – Mountainbiken, Wandern etc. – zu fatalen Störungen. Auch diese sind dann gegebenenfalls – zum Beispiel im Inn- und Salzachtal – Gegenstand von Lenkungsmaßnahmen im Rahmen des Artenhilfsprogramms. Schwieriger ist es dagegen, Störungen durch Geocaching entgegenzuwirken: Diese junge, boomende Trendsportart verschärft den Störungsdruck in vielen Revieren - bedauerlicher Weise insbesondere in den bislang oft weniger störungsgefährdeten sekundären Bruthabitaten in Abbaustätten. Diejenigen, die diesen Sport betreiben, sind aber sehr viel schwieriger zu erreichen als zum Beispiel Sportkletterer. Zahlen zur Dimension der Konflikte liegen für Bayern nur für den Südlichen Frankenjura vor: Dort sind etwa 51% aller Uhureviere durch Geocaching und die daraus resultierenden Störungen potenziell beeinträchtigt. • Fast die Hälfte aller bayerischen Uhuvorkommen liegt in Steinbrüchen und anderen Abbaustätten. Dort sind Bruten und Brutplätze durch den Abbaubetrieb gefährdet, vor allem ist ein erheblicher Anteil dieser sekundären Bruthabitate mittel- bis langfristig durch Abbaufortschritt, Verfüllung und Rekultivierung bedroht. Diesen Risiken begegnet das Artenhilfsprogramm in Unterfranken sowie in den Landkreisen Neumarkt und Amberg-Sulzbach in der Oberpfalz mit dem Aufbau enger Kontakte zu den Betreibern, durch deren Beratung und durch Maßnahmen zur Sicherung der jeweiligen Brutplätze und Sekundärlebensräume. • An windhöffigen Standorten der Mittelgebirge kommt es immer noch gelegentlich zu Konflikten mit der Windkraftnutzung, die sowohl Kollisionsrisiken schafft als auch wichtige Nahrungslebensräume entwerten kann. Die 10H-Regelung hat zwar in Bayern den Windkraftboom früherer Jahre gebremst. Sollte aber aufgrund der aktuellen Klimaschutzdiskussion auch in Bayern die Windkraftnutzung wieder stärker gefördert werden, dürften solche Konflikte wieder zunehmen. • Zumindest in den dealpinen Flusstälern beeinträchtigen auch Störungen durch die Waldnutzung die Reproduktion des Uhus erheblich und führen immer wieder zum Ausbleiben von Bruten bzw. zu Brutverlusten. Im Rahmen des Artenhilfsprogramms wurde 2018 und 2019 begonnen, zumindest im Inn- und Salzachtal in betroffenen Revieren Kontakte zu Waldbesitzern und Forstbetrieben zu knüpfen, um eine Reduzierung solcher Störungen zu erreichen.
Erstellt am: 28.09.2021

